Warum gute Bürokratie keine Belastung sein muss
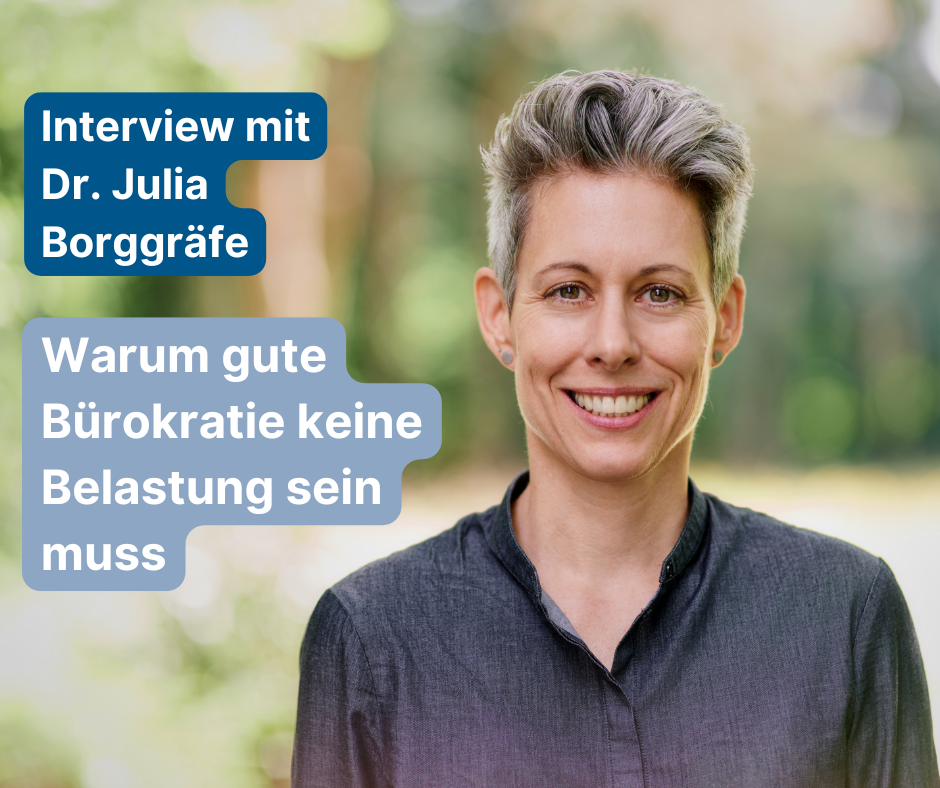
Bürokratie ist nicht das Problem – ihre Ausgestaltung schon. Im Gespräch erklärt Frau Dr. Julia Borggräfe, warum verständliche Verfahren, agile Prozesse und ein systemischer Blick entscheidend sind, um Verwaltung als Möglichmacherin zu positionieren. Dabei kennt die Co-Geschäftsführerin der Metaplan Gesellschaft für Verwaltungsinnovation und Associate Partner bei Metaplan Verwaltung auch sehr gut aus interner Brille. Denn sie war u.a. Abteilungsleiterin Digitalisierung und Arbeitswelt im Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
In Ihrem kürzlich erschienenen Buch „Bürokratopia” beschreiben Sie die Hindernisse, die durch Bürokratisierung entstehen. Gibt es eine bestimmte persönliche Motivation, weshalb Ihnen dieses Thema wichtig ist?
Die Bürokratie selbst ist kein Hindernis. Vielmehr glaube ich, dass es die Art und Weise ihrer Ausgestaltung ist. Auch eine Straße ist nur so gut wie ihr Zustand. Eine Straße kann in einem guten Zustand sein oder in einem schlechten Zustand, aber sie bleibt immer eine Straße. Das Gleiche gilt für Bürokratie. Ich finde es schwierig, Bürokratie zu verteufeln, wie es derzeit teilweise geschieht, denn Bürokratie ist zunächst einmal nichts anderes als die Verfahren, die die Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger erlebbar macht. Die Frage ist: Wie gestalten wir diese Bürokratie?
Meine Erfahrung, die dem zugrunde liegt, ist zum einen natürlich wie bei allen meine Erfahrung als Bürgerin. Insbesondere in einer Stadt wie Berlin ist es eine Herausforderung, wenn man beispielsweise umzieht. Man hat dann eigentlich eine Frist von zwei Wochen, bekommt aber teilweise erst frühestens nach drei Monaten einen Termin zur Ummeldung. Im Zweifel droht ein Strafbescheid, weil man sich nicht rechtzeitig umgemeldet hat. Das ist eine unschöne Herausforderung, die Bürgerinnen und Bürger erleben.
Und das andere waren meine vier Jahre im Bundesarbeitsministerium, wo ich eine unfassbar motivierte Mannschaft vorgefunden habe, die mit mir gemeinsam das Thema Digitalisierung und die Herausforderungen der Entwicklungen der Arbeitswelt bearbeitet hat. Die klassischen Verfahren passten einfach nicht zu den Querschnittsthemen, die wir bearbeiten mussten. Insofern haben wir angefangen, die Verfahren zu verändern. Wir haben viel ausprobiert, beispielsweise agile Formate. Dadurch sind wir zu einer Vorgehensweise gekommen, die dem Thema Digitalisierung viel besser gerecht wird. Auf diesem Wege haben wir alle viel gelernt.
Sehen Sie Bürokratie also grundsätzlich als Errungenschaft? Vielleicht auch deshalb, weil einer der Grundgedanken ist, dass sie Rechtssicherheit bieten und vor Willkür schützen soll?
Absolut. Ich bin auch Juristin. In einem demokratischen Staat bildet die Bürokratie natürlich, wie Sie es gesagt haben, die Verfahren ab, die letztendlich Rechtssicherheit und Gleichheit vor dem Gesetz garantieren. Deswegen ist es auch so wichtig, dass diese Verfahren funktionieren, damit der zugrunde liegende Grundsatz nicht darüber verloren geht, weil man sich über nicht funktionierende Verfahren ärgert.
Was könnten die Gründe für die nicht funktionierenden Verfahren sein? Oder anders gefragt: Ist es auch eine Folge der gesellschaftlichen Entwicklung, dass sich die Bürokratie teilweise so schwierig umsetzen lässt? Spiegelt die öffentliche Verwaltung vielleicht auch die Struktur und die Werte einer Gesellschaft wider?
Wenn man sich die letzten 70 Jahre anschaut, erleben wir unglaublich viele gesellschaftliche Veränderungen. Man muss nur betrachten, wie sich das Verhältnis von Männern und Frauen entwickelt hat, wie sich das Thema Digitalisierung und Kommunikation verändert hat und wie niedrigschwellig man Dinge erledigen kann, wenn es im nichtstaatlichen Bereich stattfindet. Man muss nur daran denken, wie schnell ich über meine Taxi-App ein Taxi bestellen kann, das fünf Minuten später vor meiner Tür steht, oder wie schnell Essenslieferungen innerhalb weniger Minuten geliefert werden. Da hat sich wahnsinnig viel verändert.
Die Frage ist, nach welchen Prämissen die jeweiligen Verfahren aufgesetzt werden. Die Privatwirtschaft hat für sich irgendwann festgestellt, dass sie nur noch dann wettbewerbsfähig ist, wenn sie es in einem zunehmend globalen Wettbewerb schafft, ihre Prozesse und Produkte möglichst nutzerorientiert zu gestalten. Dadurch hat sich viel verändert. Das ist in der Verwaltung ein Stück weit ausgeblieben. Das liegt natürlich auch daran, dass die öffentliche Verwaltung nicht diesem Wettbewerbsdruck ausgesetzt ist, wie es in der freien Wirtschaft der Fall ist, da die Verwaltung eine Monopolstruktur ist.
Ich glaube, dass wir uns in der Verwaltung zu wenig mit diesem Thema beschäftigt haben, obwohl sie für die Bürgerinnen und Bürger vielleicht sogar die wichtigste der drei Staatsgewalten ist, weil sie der Teil des Staates ist, den alle erleben. Die Judikative und die Legislative bekommt kaum jemand unmittelbar mit. Das Spannungsverhältnis der Verwaltung zu den Bürgerinnen und Bürgern, zur Politik, und zu den eigenen Mitarbeitern ist im System angelegt. Das kann durchaus produktiv sein – aber nur, wenn es gut gemanagt wird. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahrzehnten zu wenig Augenmerk auf das Management dieser Spannungen gelegt haben und uns stattdessen zu stark darauf konzentriert haben, Rechtssicherheit zu schaffen.
Welche Strategien würden Sie empfehlen, um ebendiese Verhaltensmuster zu durchbrechen?
Zunächst kann man sich die Frage stellen: wann sind Prozesse „gut“? Was müssen sie dafür erfüllen? Prozesse der Verwaltung müssen rechtssicher sein und demokratische Prinzipien abbilden. Sie müssen für den Menschen aber auch verständlich sein. Hier können wir besser werden. In Neuseeland hat man die Verwaltung daher beispielsweise per Gesetz zu verständlicher Sprache verpflichtet. Prozesse sollten aber auch auf die Fragen einzahlen: Welche Ziele wollen wir erreichen? Auf welche Strategie zahlen sie ein?
Und es wäre wichtig, Prozesse mit quantitativen und/oder qualitativen Kennzahlen zu hinterlegen, um überprüfen zu können, ob das intendierte Ziel mit ihnen erreicht wird. Z.B. kann auch die Kundenzufriedenheit eines Bürgeramtes eine solche Kennzahl sein.
Wenn man diese Orientierungspunkte für sich geklärt hat, kann man anschließend seine Prozesse überprüfen oder neu ausrichten. Wichtig ist, das nicht von oben herab zu entscheiden, sondern die Menschen einzubinden, die dazu auch etwas Sinnvolles sagen können. Das sind natürlich die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eigenen Fachleute, aber im Zweifel natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger – oder, um es in der agilen Sprache zu sagen, die Nutzerinnen und Nutzer. Das können auch Unternehmen oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein. Diese Personen sollte man ko-kreativ in einen solchen Prozess einbinden, so dass ein Perspektivwechsel und ein gegenseitiges Verständnis geschaffen werden kann – und dann zu sagen: „Okay, unter Berücksichtigung all dieser Perspektiven kommen wir zu einem gemeinsamen Ergebnis.”
Das ist etwas ganz anderes als das, was wir oft bei staatlichen oder öffentlich-rechtlichen Abstimmungsverfahren erleben. In der Verwaltungswissenschaft nennt man das Phänomen „negative Koordination“. Man schaut im Umlaufverfahren, was stört, und streicht es dann heraus. Am Ende steht dann der kleinste gemeinsame Nenner und nicht die beste Lösung.
Das kann sich in der praktischen Umsetzung aber als wirklich schwierig darstellen. Nehmen wir als konkretes Beispiel einen Bescheid. Dieser muss rechtssicher formuliert sein. Die Adressaten haben jedoch oftmals große Schwierigkeiten, diese Bescheide vollständig nachzuvollziehen, da sie mit Behörden- und Juristendeutsch nicht vertraut sind. Wie kann es gelingen, gleichzeitig Rechtssicherheit und Verständlichkeit zu erreichen?
Ich würde die steile These wagen – und das sage ich als Juristin –, dass man durchaus rechtssicher und einfach formulieren kann. Man kann einen Satz auch noch einmal erklären. Wenn man eine bestimmte juristische Formulierung benutzt – nehmen wir als Beispiel die „aufschiebenden Bedingungen” –, dann könnte man diese im nächsten Satz erklären. Auch da glaube ich, kann man sehr gut selektieren. Vermutlich ist hier eine Differenzierung je nach Rechtsgebiet sinnvoll.
Womöglich ist hier eine genaue Aufteilung sinnvoll? Auf der einen Seite der Jurist oder die Juristin, der/die die rechtssichere Formulierung garantiert, und auf der anderen Seite jemand, der auf Kundenkontakt spezialisiert ist.
Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt ja heutzutage auch schon erste Gehversuche, Verwaltungssprache mithilfe von KI entsprechend zu übersetzen, sodass sie gut verständlich ist. Man könnte damit eine rechtssichere, formale Verwaltungssprache mit dem Angebot eines Chatbots kombinieren, der Übersetzungsleistungen erbringt – vielleicht sogar in verschiedenen Sprachen. Damit kann man experimentieren vor dem Hintergrund der Fragestellung: wie kann ich meine Zielgruppen am besten erreichen? Ich halte diese Frage für wichtig. Möglicherweise gibt es dann auch unterschiedliche Wege, die zum Ziel führen.
Könnte das Rollenmodell der Holokratie – eine Organisationsform, die Hierarchien abbauen möchte – dabei helfen, festgefahrene Strukturen aufzuweichen?
Ich glaube nicht, dass eine Verwaltung ohne Hierarchie rein juristisch und formalistisch funktioniert. Und das ist natürlich in einem solchen Rollenmodell wie der Holokratie erst einmal schwierig. Denn hier stellt sich die Frage: wer trägt die Verantwortung für die im Prozess getroffenen Entscheidungen? Ich glaube aber, man kann das themenbezogen ausprobieren.
Außerdem: Ich habe noch kein Unternehmen gesehen, in dem Holokratie in Reinform funktioniert. Ich würde aber immer dazu raten, sich mit diesen Modellen auseinanderzusetzen. Das Gleiche gilt für agile Arbeitsweisen. Man sollte das herausziehen, was für einen selbst gut passt, und damit experimentieren, um am Ende vielleicht zu einem Modell mit verschiedenen Elementen aus verschiedenen Methoden zu kommen, die dazu führen, dass man besser arbeiten und bessere Verwaltungsprodukte anbieten kann. Der erste Schritt wäre also, sich aktiv mit diesen verschiedenen Methoden und Modellen auseinanderzusetzen und dann verschiedene Dinge auszuprobieren, um herauszufinden, was uns hilft, unsere Arbeit gut zu machen.
Was würden Sie einer jungen Führungskraft als Ratschlag mitgeben, um erfolgreich zu sein, ohne in alte Muster der Überbürokratisierung zu verfallen? Wie kann es gelingen, Innovation erfolgreich zu implementieren?
Ich glaube, es hilft immer, sich einmal vor Augen zu führen, wie die eigene Organisation tickt. Welche ungeschriebenen Regeln gibt es in der Organisation, die es zu berücksichtigen gilt? Insbesondere in der Verwaltung gibt es viele ungeschriebene Regeln, die man einhalten muss, sei es der kleine Dienstweg oder Erwartungshaltungen, die auch informell bedient werden müssen. Es ist wichtig, sich damit einmal auseinanderzusetzen. Ansonsten drohen alle Entscheidungen auf der formalen Ebene im Zweifel daran zu scheitern, weil die Leute einfach nicht mitmachen. Wichtige Personen sollten eingebunden werden, um eine gemeinsame Orientierung zu finden, zum Beispiel in Form einer gemeinsamen Zielsetzung oder einer Beschreibung dessen, was einen als Team erfolgreich macht.
Man sollte sich fragen: Welche Interessen sind relevant? Und welchen Raum braucht es, um diese gut miteinander auszuhandeln? Anschließend sollte man sich den Freiraum nehmen, um es auszuprobieren. Das ist vor allem in einer stark hierarchisch geprägten Verwaltung tatsächlich eine wichtige Aufgabe von Führung: Sie muss die nötige Sicherheit und den Freiraum schaffen, damit diese Dinge auch passieren können. Ich würde jeder jungen Führungskraft raten, bereit zu sein, dafür die Verantwortung zu übernehmen, weil das im Zweifel Leute in einem stark hierarchisch geprägten System brauchen. Sie sollten also mit gutem Beispiel vorangehen und als Führungskraft Freiräume schaffen, sodass diese Experimentierräume letztendlich mit Leben gefüllt werden können.
Eine junge Führungskraft sollte sich also ein gutes Bild davon machen, wie die bestehenden Hierarchien funktionieren und die Organisationskultur tickt, da sie sonst Gefahr läuft, gar nicht erst in die Situation zu kommen, gute Ideen tatsächlich umzusetzen?
Ganz genau, denn sowohl auf der formalen wie auf der informalen Seite gibt es sehr stabile Erwartungshaltungen. Man sollte diese also kennen, um dann auch wirklich tragfähige Entscheidungen treffen zu können.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Dr. Borggräfe!
Zur Person:
Dr. Julia Borggräfe ist Co-Geschäftsführerin der Metaplan Gesellschaft für Verwaltungsinnovation und Associate Partner bei Metaplan. Die Juristin ist außerdem Aufsichtsrätin der Digitalservice GmbH des Bundes und war über drei Jahre Abteilungsleiterin Digitalisierung und Arbeitswelt im Bundesministerium für Arbeit und Soziales.